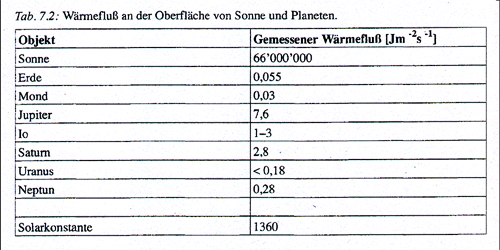Das Temperaturproblem großer Körper und Meteoriten
Das Temperaturproblem der Entwicklung der Körper um einen Stern teilt
sich in zwei Aspekte. Es ist einmal die ehemalige Temperatur der
Meteoriten und zum anderen der Wärmefluss von großen Körpern
in unserem Sonnensystem.
Die undifferenzierten Meteoriten, speziell die kohligen Chondrite, zeigen
Kalzium-Aluminium-reiche Einflüsse (CAI´s) neben kühlen Chondren.
(2.1)
Sie sind so zusammengekommen und haben sich seit ihrem
Entstehen nicht mehr verändert. Zudem sind sie die ältesten
Körper unseres Sonnensystems und spiegeln daher die
früheste Phase der Planetenentstehung wieder.
Es müssen zu Beginn der Entwicklung schon äußerst hohe
Temperaturen zwischen 1500 und 1900 Kelvin geherrscht haben,
die von außen gekommen sein müssen.
Die Olivinkörner im Allende-Meteoriten sprechen für eine schnelle
Entwicklung in einem heißen Gas, was die äußeren Schichten
dieser Körner mit FeO angereichert hat.
(2.8)
Auch die differenzierten Meteoriten lassen auf hohe
Temperaturen schließen. Die Widmannstättischen Figuren
in Eisenmeteoriten sind nur zu erklären, wenn sich ein Körper
über mehrere 10 Millionen Jahre nahe dem Schmelzpunkt hält .
(7.10)
Zudem weisen diese Meteoriten Remaglypte auf, die nur durch
die turbulente Bewegung heißer Gasmassen erklärbar sind.
(15.2)
Der Temperaturgeber kommt demnach auch hier von außen.
Um nun eine einheitliche Lösung für die erforderlichen Temperaturen
aller unterschiedlichen Arten der Meteoriten zu erhalten,
kann ein Temperaturgeber nur von außen kommen.
Das schließt die undifferenzierten Meteoriten ein.
In den Kometen, die sich auf den unterschiedlichsten
und auch sehr großen Bahnen um die Sonne bewegen,
findet man ebenfalls Olivinkörner. Olivinkörner können nur in der
Nähe des Sterns entstehen. Kometen sind demnach auch Körper,
die aufgrund ihrer inneren Zusammensetzung einen Hinweis liefern,
dass sie in der Nähe des Sterns entstanden sind.
Tabelle 1: Wärmefluss von Körpern im Sonnensystem
(19.13)
Alle größeren Körper im Sonnensystem haben eine Wärmequelle
und damit einem Wärmefluss. Sie geben mehr Wärme ab
als sie bekommen. Zudem weisen Monde, wie Miranda
Strukturen auf, die ehemals von einer hohen Temperatur
während der Entstehung sprechen. Besonders deutlich
wird der Wärmefluss bei Jupiter, da er so viel Wärme abstrahlt,
dass sie nicht mehr durch das Absinken schwerer Elemente in den Kern
oder durch den radioaktiven Zerfall erklärbar ist.
(19.12)
Wenn wir nach einer Lösung für die gesamte Problematik des
Temperaturgebers suchen, kommt meiner Auffassung nach
nur die Sonne als Träger dieser Temperatur in Frage.
Damit müssten alle Körper, hier schließe ich die Ringe
und das Kleinmondsystem der Gasplaneten aus,
in der Nähe der Sonne entstanden sein.