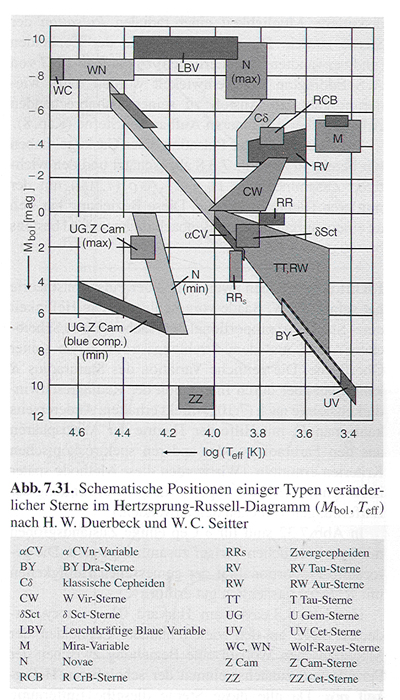Die Gravitation und die Kerne von Zweitsternen
Durch die große Masse des Zweitsterns kann es bei den heißen
Doppelsternen dazu führen, dass der Eisenkern über den hohen
Druck der Gravitation zusammenbricht. Der Eisenkern und anfangs
auch der Silikatmantel nehmen nicht an der Fusion teil.
Man hat im Sternkern eine fusionsfreie Zone. Im innersten Kern
wird demnach keine Temperatur erzeugt,
die sich gegen den enormen Druck wehrt.
Ist nun die Masse dieses Kerns groß genug, kann er einmal
zum Weißen Zwerg werden oder direkt zum Pulsaren.
Die Größe des Kerns ist abhängig von der Rotation des ersten Sterns.
Je größer diese Rotation ist, umso mehr kann auch dieser erste
Stern sammeln, und umso höher sind auch eine Temperatur
und seine Masse. Die Chandrasekhar-Grenze sorgt dafür,
dass der Eisenkern zum Neutronenkern wird wenn der Stern
seine größte Masse hat. Diese hat er, wenn er die Gasaufnahme
abschließt, denn anschließend nimmt seine Masse
ständig durch einen starken Sonnenwind ab.
Der Grundgedanke besagt, dass der Weiße Zwerg oder der Pulsar
schon im Kern entstehen bevor der Stern seine Entwicklung a
bgeschlossen hat. Über die spätere Supernova wird nur
die äußere Hülle abgesprengt, und es bleibt der Pulsar,
oder es bleibt kein Pulsar. Der Pulsar erfährt damit noch mehr Rotation.
Die Supernova wirkt als Impulsverstärker. Voraussetzung für einen
späteren Pulsaren ist der Neutronenkern im Doppelsternsystem.
(13.15)
Fällt ein Eisenkern zusammenfällt, steigt einmal die Rotation.
Damit wird auch das Magnetfeld stärker. Wenn sich die Rotation
im Kern stark erhöht, erhöht sich gleichzeitig die Rotation
des gesamten Sterns. Damit rotiert das Doppelsternsystem schneller.
Wenn sich der Kern nur über die Gravitation verdichtet,
wird er etwas schneller und erzeugt ein starkes Magnetfeld,
aber die Masse im Kern bremst den Stern eher.
Kandidaten, die zu den Doppelsternen passen, wären einmal
die CP-Sterne und zum anderen die Wolf-Rayet-Sterne.
Bei beiden Kategorien von Körpern handelt es sich um Doppelsterne.
(12.9)
(10.9)
Bei den CP-Sternen wird der Planetenkern nur verdichtet.
Auch das erhöht schon den Magnetismus. Bei den Wolf-Rayet-Sternen
finden wir zwei Arten, die im HRD nebeneinander liegen.
(28.3)
Grafik 43: Veränderliche Sterne im HRD
(41.2)
Es gibt einmal die kühleren WN-Sterne und neben
ihnen liegen die heißeren WC-Sterne.