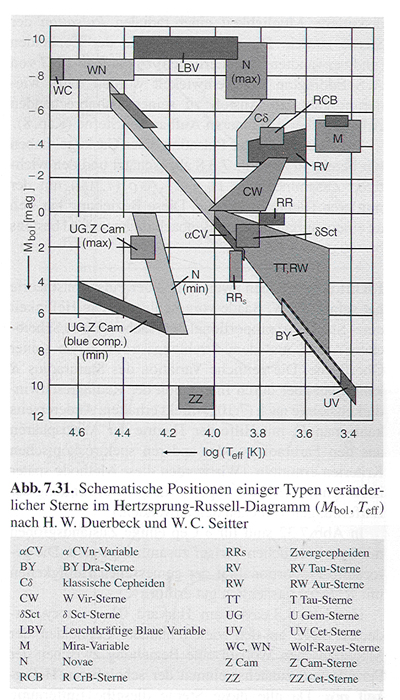Arten der Doppelsterne
Bei den kühlen Doppelsternen hätte der Zweitstern einen
Planetenkern aus Gestein. Das ist der Neptuntyp.
Doppelsterne der Temperatur unserer Sonne hätten
im Zweitstern einen Planeten aus Eisenkern und Gesteinsmantel.
Bei den heißen Doppelsternen sind die Eisenkerne und
Gesteinsmäntel im Zweitstern größer, weil sich der
Entstehungsbereich vom Erststern getrennt hat.
Bei den heißen Doppelsternen hat der Zweitstern den Eisenkern
und damit in der frühen Phase seiner Entwicklung eine
höhere Dichte. Zudem ist der Entstehungsbereich vom Erststern
getrennt und er sammelt daher schneller Masse hoher Dichte.
Sie haben damit eine geringere Abdrift und einen geringeren
Abstand zueinander als kühle Doppelsterne.
Bis zu den B3-Sternen erleben Sterne noch Krisen
während ihrer Entwicklung.
Grafik 43: Veränderliche Sterne im HRD
(41.2)
Das führt zu Konvektionszonen, die im weiteren
Entwicklungsverlauf in tieferen Schichten verschwinden.
Nur dort, wo sich Konvektionszonen um einen Stern
gebildet haben, erlebt der Stern eine Verkleinerung.
Die Konvektionszonen in tiefern Schichten sind gleichzeitig
der Grund für die Pulsation der Sterne. Die Krise des Sterns
führt dazu, dass sich zwei Körper mit Eisenkern bilden,
die beide zum Stern werden können. Im Sonnensystem
haben wir einen Jupiter und im inneren die Erde,
die ebenfalls zum Gasplanet und weiter zum Stern
werden kann. Daher spreche ich im Instabilitätsstreifen
vom gestörten Jupitertyp und dem Erdtyp, der sich weiter
zum Stern entwickeln kann. Weil der Jupitertyp durch
die Krise in der Entwicklung gestört wird und
aus der Position der Bildung des Gasplaneten springt,
kann sich der Erdtyp entwickeln. Daher existieren von
den F- bis zu en B3-Sternen zwei Typen mit Eisenkern.
Das heißt, man hat es in diesem Temperaturbereich meistens
mit Dreifachsystemen zu tun. Der Erdtyp aber auch der
päte Jupitertyp sind die Vertreter der CP-Sterne.
Der Erdtyp ist zudem der Vertreter der Zwergnova.
Alle Zweitsterne sind schwach pulsierend,
weil der Planetenkern den Puls schwächt.
Oberhalb der B3-Sterne haben wir es mit einer eigenen
Klasse von Sternen. Der Erststern hat eine unbedeutende
Krise und in seiner frühen Entwicklung. Er kennt keine
Konvektionszonen im inneren und hat daher auch keine Pulsation.
Damit entwickelt sich der Jupitertyp ungestört. Er bleibt in seiner
Position und der Erdtyp kann sich nicht mehr entwickeln.
Es gibt demnach oberhalb der B3-Sterne nur noch Doppelsterne,
und den Zweitstern bezeichne ich mit dem ungestörten Jupiter.
Der Jupitertyp ist als Zweitstern auch viel massenreicher.
Hier beginnt die Region der Supernova und der Pulsare.
Nur der ungestörte Jupitertyp kann Pulsare hervorbringen.
Damit sind die Klassen der Mehrfachsternsysteme erklärt.
Zusammenfassend kann man sagen, man muss grundlegend
zwischen dem Erststern und den Zweitsternen unterscheiden.
Unter den Zweitsternen existieren der Neptuntyp,
der gestörte Jupitertyp, der Erdtyp und der ungestörte Jupitertyp.
Damit erfasst man die gesamte Klassifizierung
der Mehrfachsternsysteme. Da Nebenperioden bei heißen
Mehrfachsternsystemen existieren, sind diese ein Zeichen dafür,
dass sich Körper wie Saturn oder Uranus ebenfalls
zu größeren Körpern weiterentwickeln können.
Bei geringerer Metallizität nehmen die Häufigkeit der Doppelsterne
und ihr Abstand zueinander zu. Eine Mindestgröße von Körpern
ist in der anfänglichen Entwicklung beim Durchdringen der Gasscheibe
vorgegeben. Es entstehen weniger Körper und diese brauchen länger,
um die kritische Masse zu erreichen. Daher wandern sie weiter weg.
Der wachsende Abstand der Doppelsterne bei abnehmender Metallizität
führt einmal bei den CP-Sternen dazu, dass weniger
Planeten und Monde in die Sterne abstürzen. Körper,
die in Sternnähe entstehen und wegwandern haben mehr Raum.
Damit nimmt ihre Häufigkeit stark ab.
(5.11)
Zum anderen führt dies dazu, dass der Zweitstern an Einfluss verliert.
Bei geringerer Metallizität entstehen mehr heiße Einzelsterne.