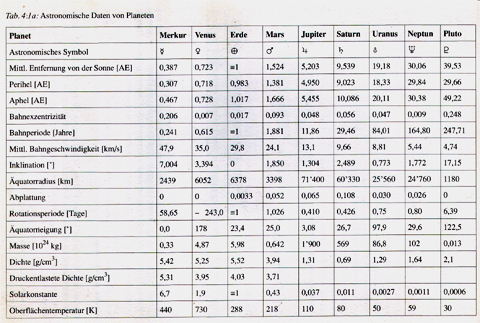Definitionen und Klassifizierungen
Die Wissenschaft arbeitet mit Definitionen. Zum Beispiel definiert die
Astronomie einerseits Körper und zum anderen Bahnen und
Eigenschaften dieser Körper. Bei den Körpern im Universum ist es
schwierig zu sagen: das ist ein Mond, oder das ist ein Planet.
Besondere Eigenschaften bestimmen jeden Körper.
Bei diesen beiden Körpern scheint es noch einfach zu sein.
Definiert man den Planeten und den Stern, scheint es sehr klar zu sein,
weil hier eine klare Definition vorliegt, die besagt, der Stern fusioniere
Wasserstoff zu Helium und der Gasplanet tut das nicht.
So glaubt man, man hätte eine eindeutige Definition.
Beginnt man jedoch ein gedankliches Spiel und stellt sich vor,
die Sonne hätte sich weiter entwickelt, dann kann man
bei Jupiter als Planeten nicht ausschließen, dass dieser es auch täte.
Da die Gasaufnahme neben der Gravitation auch an die
Rotation gebunden ist, würde er sehr schnell Gase aufnehmen,
denn er dreht sich 6-mal schneller als die Sonne.
(13.4)
(19.1)
Tabelle 5: Astronomische Daten zu den Planeten
Würde sich Jupiter zum Stern entwickeln, so hätte er einen
Planetenkern und eine Gashülle, die sich nicht viel anders
zusammensetzt als die der Sonne.
Diese Körper wäre ein Stern mit einem Planetenkern.
Einen solchen Kern hätte die Sonne jedoch nicht.
Also hätten man es mit zwei Arten von Sternen zu tun,
die beide fusionieren, jedoch anders aufgebaut sind.
Von solchen Zusammensetzungen im Doppelsternsystem
geht die Wissenschaft nicht aus. So lange die Wissenschaft
jedoch nicht weiß, wie Planeten und Sterne im Zusammenhang
entstehen, kann sie sicherlich definieren, aber es könnten trotzdem
zwei Arten von Sternen existieren.
Da die Wissenschaftler von einer Vorstellung ausgeht,
dass alle Sterne im Aufbau gleich sind und darauf
ein großes Gebäude aufgebaut, kann es durchaus sein, dass dieses
Gebäude nicht stimmig ist. Dieses Gebäude könnte demnach
nicht stehen, wenn man feststellen sollte, dass es verschiedene
Arten von Sternen gäbe. Dieser Unterschied würde sich ergeben,
wenn man die Sternentwicklung mit der Planetenentstehung verbindet.
Demnach ist es nicht verwunderlich, dass die Astronomen darauf achten,
diese beiden Entstehungen zu trennen. Sie möchten dabei bleiben,
dass auf der einen Seite die Planeten entstehen
und der anderen der Stern. Es zeigt sich jedoch,
dass einmal Exoplaneten und Braune Zwerge
sich auch da aufhalten, wo sich Doppelsterne finden.
Die Tendenz ist sogar so gelegt, dass Exoplaneten in der
Häufigkeit näher am Stern liegen als der Zweitstern.
(5.1)
Grafik 6: Asteroiden und ihre Inklination. Dieser Grafik entnimmt man
dass die E- und M-Klassen eine geringe Inklination aufweisen
(5.104)
Das könnte demnach der Hinweis sein, dass die Definition
über den Ort nicht möglich ist.
Man kann nicht einfach sagen, in der Nähe des Sterns entstehen Sterne
oder Doppelsterne und in größerer Entfernung Planetensysteme.
Die Position der Exoplaneten gegenüber dem Zweitstern erweckt
eher den Eindruck, dass der Übergang fließend ist.
Außerdem gibt es Zusammenhänge zwischen
der Häufigkeit der Exoplaneten und den Doppelsternen
im Bezug auf die Sterntemperatur.
Eine Definition von Körpern, wäre somit nur ein willkürlicher Schnitt,
um sich an Klassifizierungen festzuhalten, die eventuell nur
Übergänge sind von einer Art zur nächsten. Es geht daher eher darum,
die Entwicklung als Schritte zu beschreiben, bei denen es durchaus
möglich ist, dass man bestimmte Klassen von Körpern durchschreitet.
Genauso muss man zu einer neuen Klassifizierung von Sternen bereit sein.
Es wird nicht nur unterschiedliche Klassen von Festkörpern geben,
sondern auch unterschiedliche Klassen von Gasplaneten und
unterschiedliche Klassen von Sternen. Alle diese Typen hätten
einen spezifischen Innenaufbau, der für die jeweilige
Klassen sprechen würde.